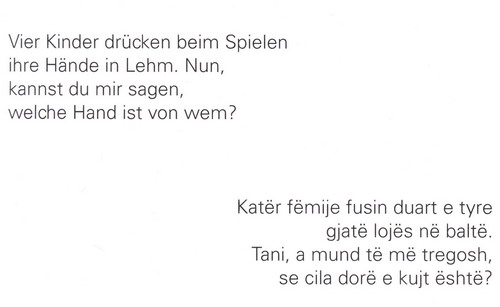2006
Yearly Archive
Mo 25 Sep 2006

Die Badesaison ist beendet und die Familiengarderobe geräumt. Einige Regentropfen fallen, aber bald verziehen sich die Wolken. Das Wasser ist 18°. Ich steige schnell hinein und schwimme gemächlich die saisonale Abschiedsrunde. Kein Mensch stört meine Bahn. Nach einer halben Stunde hole ich mir einen Kaffee im Restaurant. Dort wird eifrig geschrubbt und gefegt. Dann wird auch hier geschlossen.
Im Bus höre ich die Abstimmungsresultate. Die GewinnerInnen seien am Süssmost trinken, lauter frohe Gesichter seien zu sehen und ab und zu höre man ein Witzchen. (mehr …)
So 24 Sep 2006
Als ihm während des Mittagschlafs ein kalter Tropfen auf die Stirne fällt, erwacht Vater. Ist es Blut? Dann zerplatzt ein zweiter auf der Stirn und er denkt: „Vielleicht schlafe ich unter einem See!“
Enkelin Cornelia steigt auf die Bühne und meldet ein Loch im Dach. Es giesst in Strömen, und in der ganzen Gemeinde ist kein Dachdecker aufzutreiben. „Wir machen das selber“, beschliesst Vater, (der inzwischen 95 Jahre alt geworden ist, sehr schlechte Blut- und Nierenwerte hat und ein Herz, mit welchem man eigentlich das 50. Lebensjahr nicht erreicht.) Er steigt die ausgetretene Treppe auf die Bühne hinauf, misst das Loch aus, schneidet mit einem scharfen Schraubenzieher eine Eternitplatte zurecht, während Cornelia nach Grossvaters Anweisungen darauf sorgfältigen Gegendruck gibt. Dann schiebt er die passende Platte unter die Dachlatten. Beim Abstieg über die Treppe, hinunter in die Küche, bemerkt er eine wacklige Stufe – gefährlich für alle, besonders für die Urgrosskinder! Vater wählt ein Brett aus, spuckt an den Zimmermannsbleistift, der im Laufe der Jahre kurz geworden ist, zeichnet an, während die Enkelin ihm die klein geschriebenen Masse vorliest, sägt die neue Stufe zu und setzt sie millimetergenau ein.
Nun will der alte Mann noch etwas „sauberes“ Holz zurecht machen und ein paar Nägel, damit Kleinesmeiteli später mit dem Hämmerchen nageln kann. Den Schraubstock soll Christian bekommen und die sehr gute Pumpe gibt er wieder an Kaspars Familie zurück, die sie ihm vor Jahren geschenkt hat.
So findet nach und nach alles Gäbige und Liebgewordene einen neunen Platz.
Fr 22 Sep 2006
Mit Enkel und vollem Einkaufswagen stehe ich beim Orangen Riesen an der Kasse. Die wackelige Greisin vor mir hat der Kassierin den Geldbeutel gereicht. Nun zählt die junge Frau die paar Batzen, schüttelt den Kopf: „Es reicht nicht. Sie müssen etwas zurück geben.“ Die alte Frau schaut auf ihren Einkauf: Ein Ruchbrot, eine Budget-Packung Fruchtbonbons, zwei Bananen. „Ja, was soll ich denn am besten hier lassen?“, fragt sie bekümmert.
„Wieviel fehlt denn?“ mische ich mich ein. „1 Franken“, bedauert die Kassierin. „Hier, bitte.“ „Oh, merci vielmal, es gibt doch noch liebe Menschen“, strahlt die Frau und packt den Einkauf hurtig ein.
„Wenn ich mir vorstelle, dass ich auch einmal in ausgetretenen Hausschuhen an der Kasse stehen könnte und ich hätte einen Franken zuwenig, muss ich fast gränne“, jammerte ich auf dem Heimweg.
Mein elfjähriger Enkel: „Das wird dir sicher nie passieren, denn wir sind ja da. Mein Vater hat einen relativ sicheren Job, meine Mutter auch und ich bin auf dem besten Weg dazu, auch eine gute Arbeit zu finden.“
Sagt’s und hüpft mit dem schweren Einkaufs-Rucksack vor mir her – ich zweifle nicht daran – einer guten Arbeit entgegen.
Do 21 Sep 2006
Posted by 2nd, female under
Aus erster Hand[4] Comments
Heute traf ich beim notdürftigen Einkauf in Eile eine Mazedonierin, die ich seit Ewigkeiten kenne. Sie ist eine intelligente und interessante Gesprächspartnerin, normalerweise unterhalten wir uns trotz unterschiedlicher Auffassungen sehr zivilisiert.
Sie hat zwei von ihren drei Kindern reinrassig verheiratet und hat nun nur noch die Sorge, auch das letzte Kind – eine Tochter – an den mazedonsichen Mann zu bringen.
Heute habe ich sie mit älterer Tochter und Enkel gesehen und sie hat sich nach meiner Schwester erkundigt. Hat gefragt, was sie für ein Kind bekommen hätte und ob es ihr gut gehe. Weil ich wusste, dass ihre Tochter gerade eine Fehlgeburt hatte, habe ich mich zuerst sehr zurückgehalten. Als sie jedoch weiter und im Detail fragte, wie sich die jungen Eltern machten, bin ich leicht bissig geworden. Ich gab zur Auskunft, dass alles rund liefe, wenn denn die albanische Schwiegerfamilie sie nicht so miserabel behandeln würde. Als sie meinte, das könne ja nicht so schlimm sein, ergänzte ich, dass diese Familie uns wie auch unsere ganze Unterschicht-Nachbarschaft um ein Vielfaches an Vorurteilen übertreffe und gab ein paar Beispiele.
Ach! meinte sie, das sei nur Blabla und das erste Jahr sei sowieso schwierig!
Tja, Blabla sei für mich persönlich etwas anderes und auch gesetzlich machten wir ein paar Unterschiede zwischen Blabla, Beschimpfungen und Drohungen.
Aber, aber, meinte sie weiter, die Familie sei halt in tiefer Trauer, dass der Sohn keine Frau der richtigen Abstammung hätte – so traurig, dass sie halt gar nicht mehr sähen, dass meine Schwester ja so eine Nette sei.
Eine Nette! rief ich. Nein, mangelnde Nettigkeit sei ganz gewiss nicht das Problem. Für Geld und Bewerbungsschreiben könne man bei der Netten und dem Sohn jederzeit anklopfen, da kenne man keine Berührungsängste. (Ich sah im Geiste meinen ruhigen Schwager sich meinetwegen durch alle Böden schämen, aber ich vermochte mich nicht mehr zu bremsen.)
Heute eine Nette, morgen eine Nutte, wie es gerade beliebt, nicht wahr? Aber alle Albanerinnen sagen mir, das seien nur leere Worte, nicht schlimm, nur Ausdruck von Trauer; verständlicher Trauer. Allah hu Akbar aber nur Worte ohne Inhalt? Alle Rede ohne Bedeutung, hä? Befinde ich mich eigentlich im Europa des 21. Jahrhunderts um mir Abstammungstheorien und Blut-und-Boden-Rhetorik anzuhören?
Nein. Ich sagte nicht, verreist doch alle zurück auf eure Scholle, damit jedes Kind reinrassig bleibe. Nein, mein politischer Schutzengel hat mich gerettet. Heute, 14:12, in einer trostlosen Denner-Filiale am Rande der Stadt.
Der weiss, was sich gehört. Und ist da, wenn es drauf ankommt. Danke sehr.
So 17 Sep 2006
Posted by 2nd, female under
Aus erster Hand[3] Comments
Nicht etwa die Mutter hatte Verspätung beim Zeichnen der Geburtsanzeige. Nein, die Tante hatte Verspätung beim Scannen. Obwohl sich so viele erkundigt haben. Entschuldigung.
Vorderseite:

Rückseite:
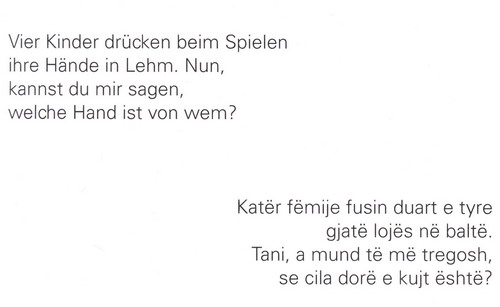
Fr 15 Sep 2006
Eingesperrt sein ist für mich eine Katastrophe. Mein Puls rast, ich bekomme Atemnot und schlottere am ganzen Körper. Als Kind habe ich in diesen unangenehmen Momenten zu schreien versucht, was aber wegen der Atemnot eher wie ein erbärmliches Krähen klang. Ich erinnere mich, wie ich röchelnd an Türe und Wände gehämmert habe um auf mich aufmerksam zu machen. Wir wohnten in einem Block im zweitobersten Stock mit einem altertümlichen Lift, der mitunter irgendwo stecken blieb. Und manchmal hat mich auch meine Neugier irgendwo reingeführt, wo ich dann nicht mehr rauskam. Tja.
Mit zunehmendem Alter haben sich die Angstsymptome in diesen Momenten nicht verändert. Aber ich habe mit mir zu quasseln gelernt um mich der Angst nicht völlig zu überlassen: „Ich bin eingesperrt. Das ist ja schon mal nichts Unbekanntes. Es ist überflüssig mich aufzuregen. Ich kenne mich ja damit aus. Also immer mit der Ruhe, dann bin ich schon halb draussen. Gut. Was sind die Fakten? Ist mein Leben hier drinnen bedroht? Nein – gut! Also nur ruhig. Komme ich allein wieder hier raus? Gibt es einen Fluchtweg? (Ich checke die Wege durch.) Nein, ohne Schlüssel oder Brecheisen ist nichts zu machen. Also weitere Fragen. Kann mich jemand hören? Vielleicht – aber meistens ist Schreien oder Hämmern zu energieraubend. Gibt es ein Telefon und funktioniert es? …..“
Es gibt Menschen, die über Jahre eingesperrt sind und dabei teilweise massiv bedroht werden. Wie halten die das durch?
Heute wurde von meiner Wirbelsäule ein MRI gemacht. In der Nacht davor hatte ich Alpträume. Als ich heute Morgen die Röhre sah, bekam ich Atemnot, auf der Liege Herzrasen. Die Praxisassistentin schob mich mit einem „Es ist halt sehr laut und Sie dürfen sich wirklich nicht bewegen!“ ab. Da drinnen das blanke Entsetzen! Nach Minuten machte sich allmählich mein Gequassel wieder laut: „Ist mein Leben hier drinnen bedroht? Nein – gut! Also nur ruhig. Was sind die Fakten?….“
Was nach dem Tod mit uns passiert, konnte bis heute noch nicht abschliessend geklärt werden und um wirklich alle Vorkehrungen getroffen zu haben:
Liebe Freundinnen und Freunde, bitte sorgt dafür, dass ich nach meinem Tod nicht in einen Sarg gelegt werde, bitte verstaut auch meine Asche nicht in einer Urne, bitte legt mich in kein Grab und tut keine Platte drauf. Die Fakten wären in diesem Fall nicht sehr beruhigend. Bitte lasst meinen Körper verbrennen und streut die Asche in den Wind – am Meer oder in den Bergen weht meistens einer.
Do 14 Sep 2006
Lehrbuch für Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, 9. Aufl., München, Urban & Fischer, 2005:
„Um den Textfluss nicht zu stören, wurde bei Patienten und Berufsbezeichnungen die grammatikalisch maskuline Form gewählt. Selbstverständlich sind in diesen Fällen immer Frauen und Männer gemeint.“
Mi 13 Sep 2006
Wenn sie „wir“ sage, meine sie sich allein. So könne sie die unterschiedlichen Arbeiten während des Tages besser bewältigen, erzählt mir meine ehemalige Schulkollegin Theres. Interessant, denke ich und fahre ein paar Stationen in ihrem Bus mit. Sie habe dann das Gefühl, es seien viele am Werk und nehme alles viel lockerer.
Das wollen w i r gleich ausprobieren!
Di 12 Sep 2006
In meinem ersten, mit Spannung erwarteten Schulbericht stand: „… sie weiss, dass Lügen kurze Beine haben …“.
Dieser Satz gefiel mir sehr und ich war überzeugt, dass etwas auf kurzen Beinen herzig aussieht: kleine flinke Lügelchen, die zwischen den langen Menschenbeinen hindurch huschen.
Obwohl mir in der Sonntagsschule erzählt wurde, dass Gott bei jeder Lüge einen Strich mit dem Griffel in sein Goldenes Buch mache, habe ich mir doch ab und zu eine solche geleistet. Da alle um mich herum nur die Wahrheit sagten, fand ich, wären ja Griffel und Buch überflüssig und Gott hätte nichts zu schreiben.
Aber nun dies!
Es gibt einen namens Constantin, der mich im September 1997 angelogen hat. Und ich Trottelin habe ihm jedes Wort entzückt geglaubt. Habe seinen Schrieb sogar archiviert als besondere Perle – neun Jahre lang, in der „Fussball“-Schachtel! Diese Lüge hatte jedenfalls keine kurzen Beine, wie mir die Lehrgotte weismachen wollte.
Schnellere NZZ-Folio-LeserInnen wissen natürlich, dass ich über „Das grösste Kunstereignis 1929“ von Bert Brecht spreche.
Ehrlich gesagt, von alleine wäre ich dem Constantin S. nicht auf die Schliche gekommen. Ehrlich gefragt, ist das nicht das Beispiel einer himmlisch langbeinigen Lüge, bei welcher der göttliche Griffel liegen bleiben muss?
Mo 11 Sep 2006
So 10 Sep 2006
Ich deponiere meinen Korb mit den Dahlien, Eiern und Beeren auf dem rechten Vorderrad des 14ers. Atemlos lässt sich eine Frau in den Sitz mir gegenüber nieder, stellt eine schwere verschnürte Kartonschachtel ab und fächelt sich Luft zu: „Entschuldigen Sie bitte den Hotdog-Geruch. Er kommt nicht aus der Schachtel. Ich bins, die so stinkt.“
„Kein Problem, ich rieche nichts“, beruhige ich sie.
„Ich war seit heute früh bis jetzt am Hot-dog-Stand bei Loeb. Das Stück kostete heute 125 Rappen, zum 125. Jubiläum, in der Haushaltabteilung im 3. Stock. Die Leute standen Schlange, drängelten aber nicht, die Stimmung war unglaublich friedlich.“
Seit 25 Jahren arbeite sie in der Buchhaltung von Loeb, sei immer korrekt bezahlt und gut behandelt worden. Sie sei zwar sehr müde, aber es habe so richtig „gfägt“ dieses Jubiläum.
Zwischen den Haltestellen Brunnmatt und Säge lassen wir beiden Frauen unsere persönlichen Highlights dieses Warenhauses kurz aufleben.
Ich erzähle ihr von dem sensationellen Einbau der Rolltreppe im Jahre 1956. Unten und oben standen elegante Herren bereit, um dem entzückten und oft ängstlichen Publikum beim Auf- und Abstieg behilflich zu sein. Dann, anfangs der Sechziger, wurde im Untergeschoss eine Buchhandlung mit Kinder- und Jugendbüchern eröffnet. Ich trug jeden Rappen in dieses Sousol, immer bestens beraten und in allen Lesewünschen ernst genommen von den beiden Buchhändlerinnen, was damals in Bern aussergewöhnlich war. Fasziniert haben mich auch die Schaufenster des Hauses. Kaum einer kannte Tinguely, als er in einem der Fenster eine Maschine installierte, welche Teller von einem Stapel griff, sie über ein Förderband ruckeln liess an dessen Ende eine Eisenhand sie packte und an die Wand schmiss. Das war Kunst vom Ämüsantesten und hat Unzählige angelockt.
Wir beiden Frauen hätten genug Stoff gehabt, um nach Paris zu fahren.
Kurz vor dem Aussteigen griff die Frau in den Karton, nahm einen Brotanschnitt heraus: „Für die Hotdogs mussten wir die Mürggeli abschneiden. Ich hab sie alle mitgenommen. Morgen bringe ich sie in den Tierpark als Futter für die Viechli!“
Mit solchen MitarbeiterInnen, die nichts verkommen lassen, kann man die nächsten 125 Jahre getrost in Angriff nehmen.
Fr 8 Sep 2006
Posted by 2nd2nd, female under
Alles oder nichts[2] Comments

Ältester Sohn mit Frau, Kind und Schwester im Ausland, jüngster Sohn in der Schule, Ehemann bis 15:00 Uhr ausser Haus; deshalb packte meine „einsame“ Schwiegermutter die einmalige Gelegenheit beim Schopf und besuchte uns das erste Mal. Bereits hier dachte ich: Blogkstoff. Sie brachte meinem Mann sein Lieblingsessen, drei Paar Socken (Styled in Türkiya) und ein Unterhemd, mir zwei Paar Kniestrümpfe und dem Bébé die Söckchen und ein selbst gestricktes weisses Libli. Ich machte ihr einen Kaffee und liess sie unsere Hochzeitsbilder anschauen.
Bevor sie sich wieder die sieben Stockwerke hinunter schlich, wickelte sie das Bébé traditionsgemäss ein. Nur der Verband um das Päckchen Mensch fehlte und so blieb das Kind glücklicherweise nur eine Minute bewegungslos.
Beim Abschied bat sie ihren „verlorenen“ Sohn, niemandem von ihrem Besuch zu erzählen. Trotz meiner Zurückhaltung und übertriebenen Freundlichkeit fragte ich sie, ob denn der grosskotzige grosse Sohn unser aller Präsident sei. Sie antwortete, er habe halt der Familie den Kontakt mit uns verboten und basta.
Diese Welt, sieben Stockwerke unter mir, werde ich mit noch so viel Empathie niemals verstehen können. Apropos, hoffentlich verbringe ich nächsten 14. Juli in Frankreich.
Do 7 Sep 2006
Posted by 2nd2nd, female under
Alles oder nichts[4] Comments
Ihr hattet recht: ausser, dass ich das Kindlein verwöhne, komm ich zu fast gar nichts. Immerhin spazieren wir regelmässig im und um den Block. Dabei treffen wir immer viele Leute, die das Bébé anschauen und gratulieren wollen.
Auch den Arabisch sprechenden Lulatsch haben wir getroffen. Dieser, der diverse Dinge (T-Shirts, Nastücher, Zigarettenpackungen, Kondome) aus dem Fenster wirft. Als mein Mann ihm das zum x-ten Mal verboten hatte, rief der Blockverschmutzer extra an und bat, ihm zu verzeihen, sonst würden seine Depressionen zunehmen. Das offene Fenster dient ihm weiterhin zur Entsorgung. Der Verwalter seinerseits kündigt solchen Mietern normalerweise, dieser aber scheint ihm leid zu tun. Der Araber sei halt ein bisschen krank und sehr vergesslich. Als der Lulatsch uns sah, kam er, beugte sich fast gar in den Snugli, legte seine Hand auf den kleinen Kinderkopf und flüsterte etwas von Bismillah und Mohammed, dann küsste er das Bébé auf seine dunklen Haare und ging von dannen.
Dann besuchten wir noch eine kaum Deutsch sprechende Albanerin, die eine Prise Zucker in den Snugli streute, damit das Kind eine Zuckersüsse werde. Zuhause wusch ich natürlich sofort ihr Gesichtlein, will keine prädentalen Probleme, weil sie sich schon Zucker von den Bäckchen leckt.
Zum Schluss, als wir auf dem Spielplatz waren, kam doch ganz zufällig meine Schwiegermutter und nahm ihr kleines Grosskind in den Arm. Ganz zufällig hatte sie ihre Handarbeit dabei. Ich setzte mich neben sie auf die Bank und fragte, was sie stricke – und ganz zufällig machte sie Söcklein für unsere Kleine.
Mi 6 Sep 2006
Am Nachmittag diverse Kurzreferate zur neuen Betriebsorganisation.
Der Leiter einer Arbeitsgruppe beruhigt die MitarbeiterInnen:
„Niemand wird zwangspoolisiert und es werden keine Pflichtenhefte ausgehöhlt!“
Das muss gut werden!
Di 5 Sep 2006
Posted by 2nd, female under
Aus erster Hand[3] Comments

Inzwischen sind die Himbeeren schon über die ersten Schnüre hinaus gewachsen. 3rd konnte vorigen Samstag umfangreich ernten.
So 3 Sep 2006
Nur selten drücke ich im Lift den Knopf U4. Eine Treppe unter dem 4. Untergeschoss befindet sich der Block-Keller. Abfluss und Heizungsrohre führen den Wänden entlang. Stabile Eisentüren deuten darauf hin, dass dies auch der Luftschutzkeller dieses Hauseingangs sein sollte. Zwei der durch Holzleisten abgetrenneten Verschläge mit Apfelhurden, die im „Ernstfall“ zu Notbetten umfunktioniert werden könnten, gehören zur Wohnung im 13. Stock. Ich öffne das Vorhängeschloss und nehme die benötigten Büchsen mit dem Harzlack heraus. Hier unten ist es sehr still. Einige der Abteile sind mit Gerümpel voll gestopft. Zwischen Laufgittern, Autoreifen, Schischuhen und ausrangierten Fernsehern stehen zu meinem Erstaunen auch Reihen von Konfigläsern, liebevoll beschriftet, Batterien von Einmachflaschen der Marke „Bülach“, verstaubt und leer, aber parat für den „Ernstfall“, ein Sack Kartoffeln, ein Korb Zwiebeln.
Eigentlich haben wir hier im Block alle ländliche Wurzeln, seis im Emmental oder auf dem Längenberg, in Galizien, Calabrien, Kosovo, Anatolien, Tamil Nadu, im Hochland von Vietnam, im Magreb …
Ich erinnere mich an meinen Einzug ins Quartier vor mehr als dreissig Jahren. Von „Zuhause“ hatte ich einen Dreschflegel und einen alten Mehlsack mit der Aufschrift „Ernst Zbinden von Längenberg 1883“ in die Stadt mitgebracht und hängte diese an die Wände aus Beton.
Seit Jahren ruhen die beiden Relikte einer vergangenen Zeit in einem der beiden Kellerabteile.
Der Block ist längst mein Zuhause geworden.
Do 31 Aug 2006
Posted by 2nd, female under
Aus erster Hand[2] Comments
Seit ich denken kann kommen Leute hierher, um unser Quartier zu besichtigen. Mal Wohlwollende, die die corbusier’sche Tradition zu erkennen glauben, mal Nasenrümpfer, die sich einfach einen Loop genehmigen, bevor sie den Wanderweg unter die Füsse nehmen, mal Kunststudenten, die Wohnbeton anfassen und artgerecht verwursten wollen und mal Gelangweilte, die von irgendwem zur Schnuppertour verdammt wurden.
Heute waren’s Jugendliche aus einem Gymnasium, die die Aussenquartiere kennenlernen sollten. Schon auf dem Bus sind sie mir als zu sauber und teuer gekleidet ins Auge gesprungen, auch weil sie über dies und das geschnödet haben, das Eingeborene längst nicht mehr wahrnehmen. Aber ich dachte halt, die kommen jemanden besuchen, immerhin schaffen es von unserem Schulkreis auch 14% aufs Gymnasium.
Ich spreche also gerade mit einem, der eine Lehre bei der Bank macht und sehr zufrieden ist, wechsel im Laufen zu einer Gesprächspartnerin mit vier Kindern, die mit mir etwas in Sachen Quartierverein besprechen will und höre dann mit einem Ohr, wie einer der sauberen und teuer gekleideten Jungs aufschreit: „Hei, sogar die hie hei e Schuel!“ während er auf unsere verspucktes Schild zeigt, auf dem „Schule“ und ein Pfeil nach unten steht, weil die Schule eben unten ist.
Ich habe ihn lächelnd aber ohne ein Fünkchen Humor bestätigt, „Jawohl. Dieses Land hat einmal beschlossen, dass jeder eine Schule besuchen darf, sogar wir hier. Leider hat das Land dann lange Zeit vergessen, dass Schulen wie Quartiere auch gepflegt werden müssen, vor allem wenn die Leute zu arm dran sind, um es selbst zu tun. Lassen Sie mich drei Mal raten, aus welchem Stadtteil so viel Hochnäsigkeit herkommt?“ Das Jüngelchen guckt ein wenig erstaunt, bleibt aber cool und meint „Also, ja, klar.“ „Spiegel?“ „Nein.“ „Kirchenfeld?“ „Ja.“
Ich gehe zufrieden nickend von dannen und erheitere mich an der Frage, wie er diese Begegnung mit der autochthonen Bevölkerung in die Gruppenarbeit einbringen wird.
Mi 30 Aug 2006
Posted by 2nd2nd, male under
Alles oder nichts[7] Comments
Gestern hatte ich mehrere Termine in verschiedenen Wohnungen. Der Bodenleger und der Storenmonteur waren im Block. Morgens um 08:18 erhielt ich eine anonyme SMS:
Bitte nicht Läuten.. Bedienen Sie sich Die Türe ist Offen. Merci
Mi 30 Aug 2006
Posted by 2nd, female under
Aus erster Hand[3] Comments

Zu Grossvaters 95. Geburtstag beginne ich eine Serie mit Bildern seiner wunderlichen Eigenart, alles verbinden zu wollen.
Di 29 Aug 2006
Posted by 1st, female under
Alles oder nichtsNo Comments
Es sind schon einige Jahre her, als ich nach einem langen Arbeitstag den Briefkasten öffnete und eine an mich adressierte „Senioren Zeitung“ vorfand. Ich überflog die erste Seite zum Thema „Finanzielle Absicherung im Alter“ gedruckt in einer grossen verlaufenen schwarzen Schrift. Im 12. Stock angekommen, schleppte ich mich müde in den 13. und war überzeugt, dass ich, läse ich weitere Nummern dieses tristen Blattes, mich um eine Vorsorge nicht zu kümmern brauchte.
Ich refüsierte die Gratiszeitung und erhielt dann noch ab und zu eine Anfrage der Redaktion, ob ich jetzt nicht doch … ?
Inzwischen ist das Angebot an 50plus-Produkten bald so gross wie dasjenige von Migros Budget.
Eine schöne Sache hat sich der Kaufmann Verlag in Lahr einfallen lassen: die Programmlinie 50plus. Die Verantwortlichen, welche „wissen, dass ihre Kunden schon viele Bücher konsumiert haben“, machen sich eifrig daran, diese Zielgruppe zu definieren. „Niemals darf das Kundensegment als Senioren überschrieben werden, keinesfalls dürfen nur Titel gewählt werden, die Probleme des Alters schildern“. In den 50plus-Regalen, zu welchen die BuchhändlerInnen erst noch überzeugt werden müssen, sollen Bücher mit „angenehm grosser Schrift“ in handlichem Format mit Lesebändchen stehen. Die 50plus-Generationen werden über „so genannte Kohorteneffekte“ angesprochen. Ganz klar besuchen die Pioniere dieses neuen Verlagprogramms Spezialmessen wie „66er“ (?) und „Seniorentage“, damit sie die Bedürfnisse ihrer neuen ZG besser kennen lernen und immer am Puls (hi,hi) der Zeit sind. Bei der in Zürich durchgeführten Umfrage meinte „weiblich, 60“: „Wichtiger als fachliche Kompetenz ist mir, dass das Personal liebenswürdig und nett ist.“
Ich persönlich habe gerne beides: Fachkompetenz und nette Liebenswürdigkeit. Dazu meine ich, dass LeserInnen jeden Alters ein Recht auf ein schön gestaltetes Buch in handlicher Form mit gutem Papier, der richtigen Schrift + Lesebändchen haben!
Hier noch der aktuelle Bestseller aus dem Kaufmann Verlag: Kuhn, Johannes: Ich bin vernügt, erlöst, befreit – Von der Kunst, alt zu werden.
(Dieser Bericht basiert auf einem Artikel im Schweizer Buchhandel 8/06, den ich leider nicht verlinken kann, da es sich um die neueste Nummer handelt.)
« Vorherige Seite — Nächste Seite »